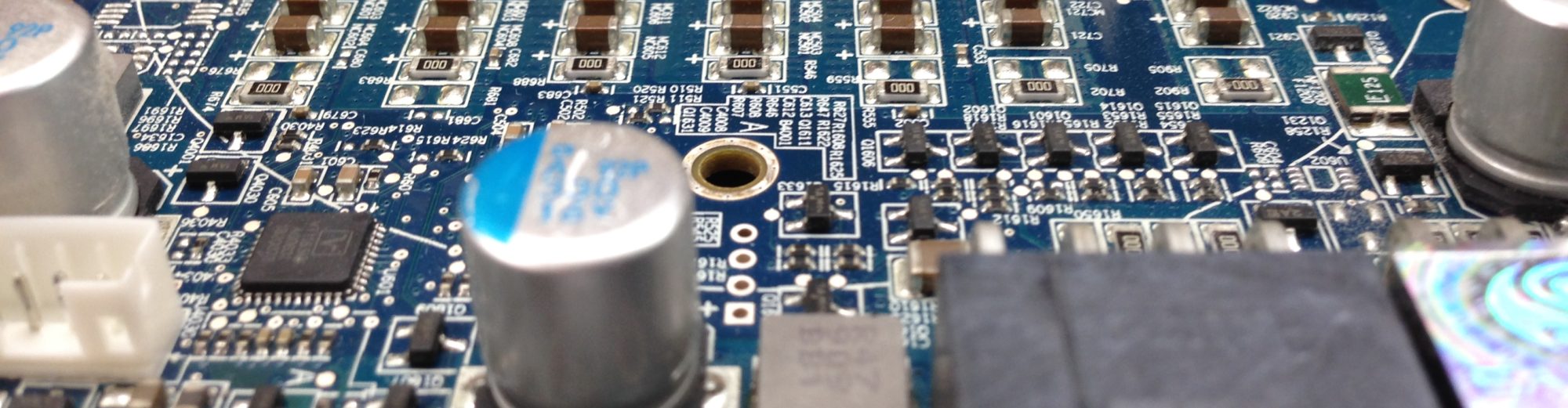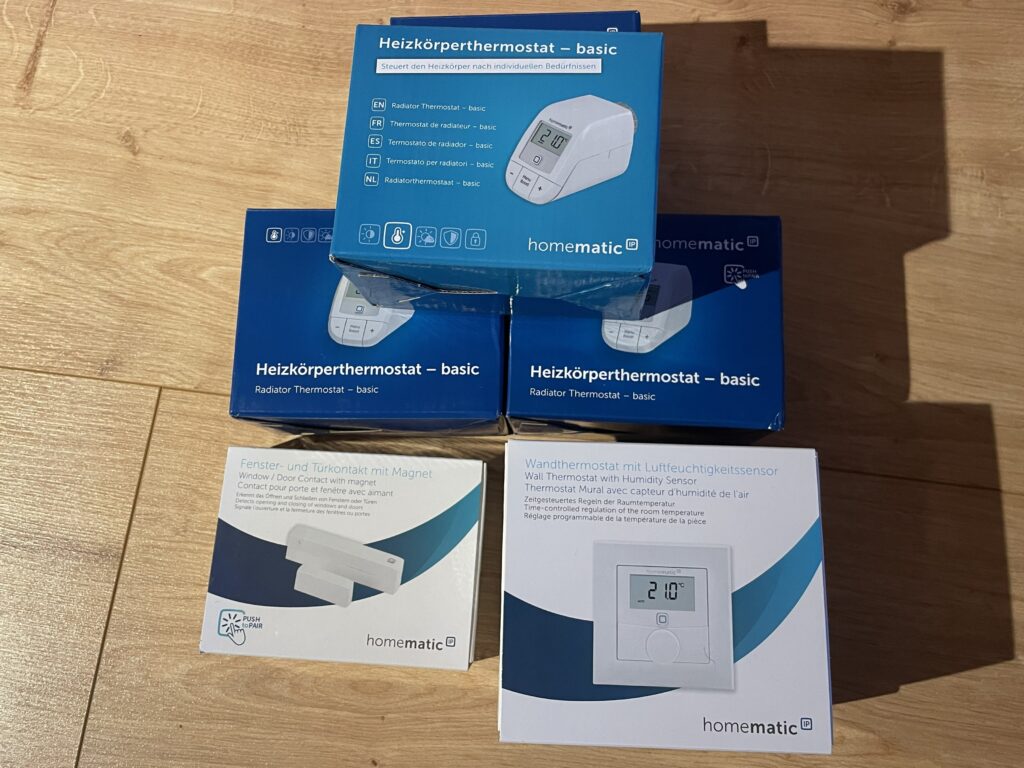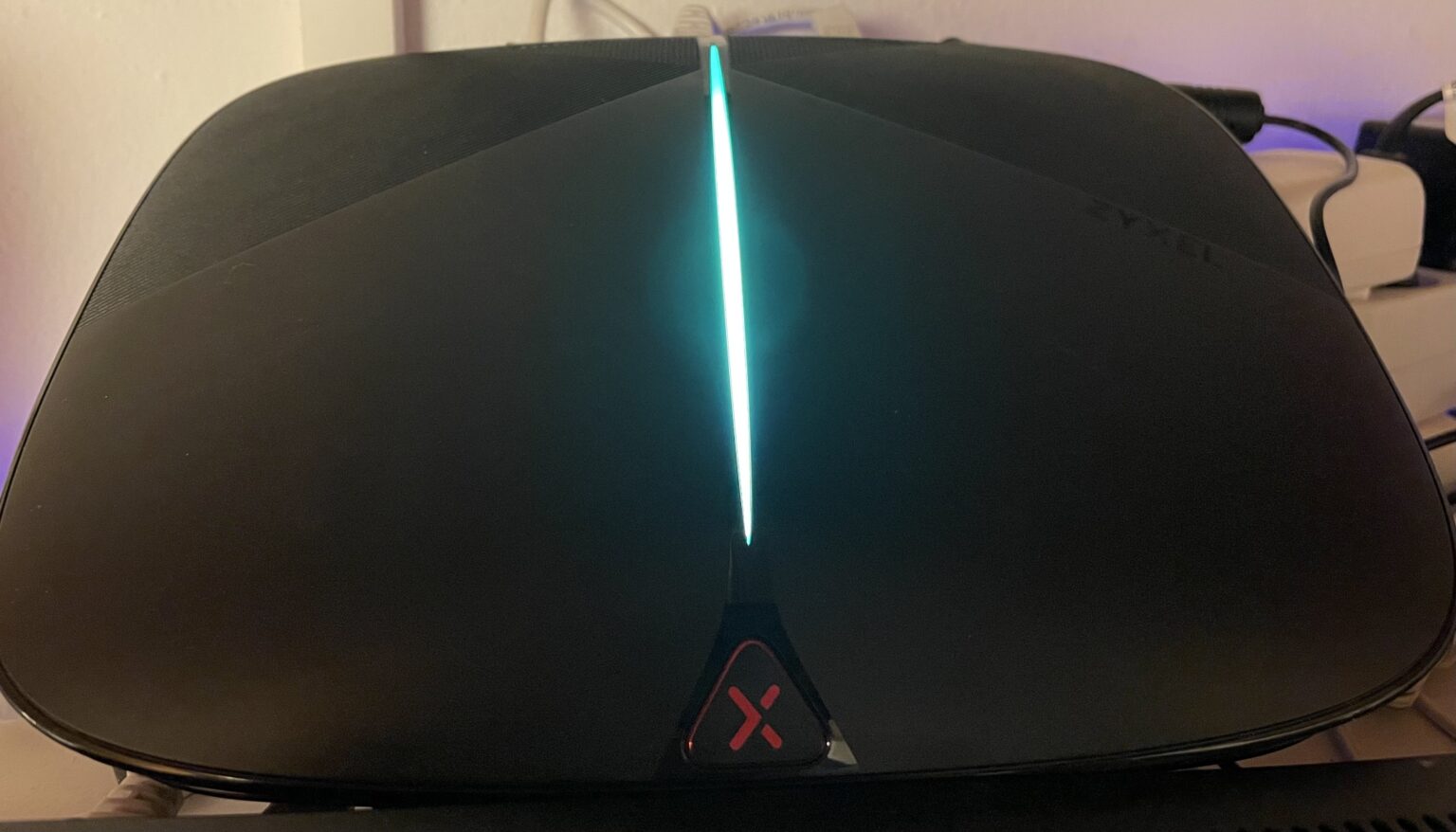Schon seit geraumer Zeit betreibe ich in meinem Heimnetz eine OPNsense Firewall. In diesem Beitrag (Teil 1) soll es darum gehen, was eine solche Lösung im Heimnetz nützt, welche Nachteile man evtl. in Kauf nehmen muss und welche Hardware sich zur Umsetzung eignet.
Dies ist als mehrteilige Serie gedacht. In Teil 2 geht es um meine konkrete Umsetzung bzw. die verwendete Hardware und bei Interesse und Zeit könnten auch noch weitere Beiträge folgen. Alle weiteren Beiträge werde ich auch hier verlinken.
Die Vorgeschichte (wie ich auf die Idee kam)
Meine Wohnung besitzt einen mit meinem Vermieter geteilten Kabelanschluss (Vodafone Kabel, ehemals Kabel Deutschland), was in der Theorie schön hohe Internet-Geschwindigkeiten von 500Mbit/s Down und 50Mbit/s Up ermöglicht, weshalb ich von diesem Angebot gerne Gebrauch gemacht habe. Leider hat so ein Kabelanschluss aber auch Nachteile – Kabel ist grundsätzlich ein „Shared Medium“, man teilt sich die Bandbreite also mit den Nachbarn, weshalb die tatsächliche Geschwindigkeit besonders in den Stoßzeiten durchaus auch mal deutlich niedriger liegen kann. Das eigentliche Problem begann aber, als während Corona, als ich den ganzen Tag im Homeoffice bzw. Online-Studium saß, der Kabelanschluss mehrere Wochen am Stück ausfiel. Das war verständlicherweise eher schlecht, weil ich natürlich auf einen funktionierenden Internetanschluss angewiesen war. Als das Ganze sich dann ein halbes Jahr später ein weiteres mal wiederholt hat, ist mir der Geduldsfaden gerissen, und ich habe einen DSL-Anschluss bei der Telekom gebucht.
Der DSL-Anschluss funktionierte zwar viel zuverlässiger als der Kabelanschluss (wobei man fairerweise erwähnen muss, dass ich wahrscheinlich einfach nur Pech hatte: seit dem zweiten längeren Ausfall vor einigen Jahren läuft auch der Kabelanschluss stabil), war aber natürlich deutlich langsamer: nur 200 Mbit/s im Download, nur der Upload war immerhin gleich (50Mbit/s). Also kam ich auf die Idee: „Was, wenn ich die Geschwindigkeit beider Internetleitungen kombinieren kann?“ Man gönnt sich ja auch sonst nichts.
Im Folgenden werde ich nun etwas ausführlicher auf die für mich entscheidenden Vorteile eingehen und anschließend ein kurzes (Zwischen-)Fazit ziehen.
Weiterlesen →